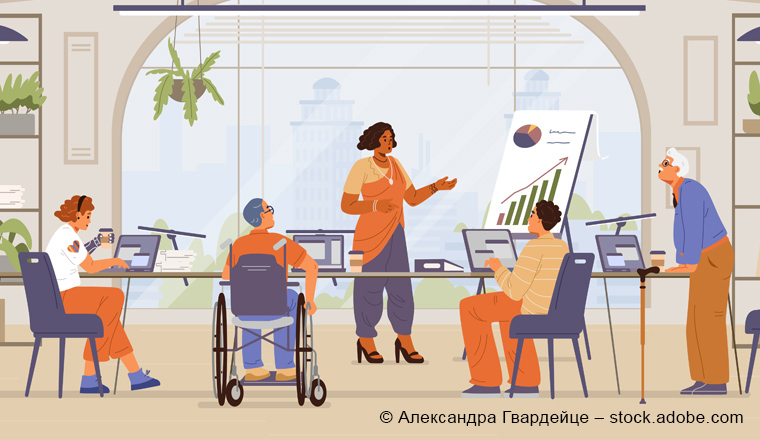Ein Artikel von Stephan Kaiser, Diplom-Mathematiker (Univ.) und geschäftsführender Gesellschafter der BU-Expertenservice GmbH
Vor einigen Jahren konnte man bei kniffeligen Fällen in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) noch häufig den folgenden Satz aus den Leistungsabteilungen entgegnet bekommen: „Wir sind doch nicht dazu da, dem Kunden nachzuweisen, dass er berufsunfähig ist.“ Die Aussage zeigt deutlich eine nicht vorhandene Kundenorientierung. Hierzu gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte: Es gibt auch heute noch ein paar Versicherer, deren Credo das zu sein scheint. Nun aber die gute: Diese Versicherer werden weniger. Bei vielen Versicherern hat ein Umdenken eingesetzt, denn eine gute Regulierungspraxis ist ein Aushängeschild. Es scheint, als ob eine neue Generation von Vorständen, Verantwortlichen und Sachbearbeitern langsam ein anderes Denken in die Branche bringt.
Reduzierung der Bearbeitungszeit
Plötzlich sind Bearbeitungszeiten wichtig und wollen reduziert werden. Gut so, es dauert aber immer noch grob um die sechs Monate. So lange in der Luft zu hängen und auf die meist existenziell bedeutende Entscheidung warten zu müssen, zerrt an den Nerven der Versicherten. Aber es ist ein Trend zur Beschleunigung zu erkennen. Viele Versicherer behandeln zumindest einfache Fälle mittlerweile entsprechend vereinfacht, weil nun eine Art Triage am Beginn der Prüfung steht.
Ist ein Leistungsfall aber so komplex, dass eine Begutachtung nötig erscheint, wird aus einem halben Jahr Bearbeitungszeit schnell ein ganzes. Die Ärzteschaft ist überlastet, es gibt lange Wartezeiten. Eine unerträgliche Situation für die Versicherten. Das haben mittlerweile einige Versicherer erkannt und helfen damit, diese Wartezeit mit einer Kulanzleistung finanziell zu überbrücken. Mindestens ein Versicherer hat dies sogar schon in seine allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) aufgenommen. So lobenswert das ist, es doktert nur an den Symptomen herum und löst nicht das eigentliche Problem: die Begutachtung. Man sollte sich langsam nach Alternativen zur Begutachtung umsehen, zumindest aber – und das wäre sehr gut machbar – diese stark reduzieren.
Hilfe bei der Antragstellung
Einige Versicherer bieten Hilfe beim Ausfüllen der Anträge an, ein sogenanntes Tele-Claiming. Hierbei gehen Sachbearbeiter meist via Telefon den Antragsfragebogen mit dem Versicherten durch, befüllen ihn vor und übersenden ihn dann zur Korrektur und Unterschrift. Nur wird dieses Angebot sehr schlecht angenommen. Möglicherweise deshalb, weil der durchschnittliche Versicherungsnehmer nicht weiß, ob er diesem Angebot trauen kann. Daran gilt es seitens der Branche zu arbeiten.
Der Versicherer muss „mitspielen“
Ein Leistungsfall scheint immer eine von Beginn an ungleiche Sache zu sein. Vergleichen wir es mit einem Fußballspiel: Es spielt der 1. FC Kunde gegen den BSV Zitronia. Die Zitronia aber hat nicht nur die besseren Spieler und Trainer, sie darf auch immer das Schiedsrichtergespann stellen. Der, der die Leistung bezahlen soll, entscheidet, ob er das will. Und obwohl Versicherer so tun, als ob sie dabei sehr objektiv seien, sind sie es natürlich nicht. Sie sind aktiv Beteiligte.
Somit bleibt eine wichtige Erkenntnis: Da der Versicherungsnehmer in der Nachweispflicht ist, muss der Versicherer mitspielen, um die Leistungen auch zu bekommen. Gerade so diffizile Erkrankungen wie psychische Beschwerden können nicht direkt nachgewiesen werden. Kein MRT kann eine Depression farblich aufzeigen, mit einem Blutbild kann kein Depressionsfaktor bestimmt werden. Die Apparatemedizin kann derartige Erkrankungen nicht nachweisen. Fachärzte können nur versuchen, sie glaubhaft zu machen. Und das macht es natürlich sehr leicht, Zweifel anzumelden. Das heißt, der Versicherer muss auch gewillt sein, seinen Pflichten nachzukommen. Was, so die Erfahrungen in den letzten Jahren, bei einigen Versicherern wirklich angekommen zu sein scheint. Um es kurz zu machen: Die Leistungsregulierung ist ein hausinternes, kulturelles Thema. Ist die Unternehmenskultur schlecht, ist es meist auch die Regulierung.
Probleme beim Nachweis von Erkrankungen
Ein Paradebeispiel für diese Szenarien bietet sich derzeit mit den sogenannten Post-Covid- und Post-Vac-Symptomen (PCS bzw. PVS). Die Leitlinienempfehlung des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) definiert „Long Covid“ als gesundheitliche Beschwerden, die jenseits der akuten Krankheitsphase einer SARS-CoV-2-Infektion von vier Wochen fortbestehen. Als PCS werden Beschwerden bezeichnet, die noch mehr als zwölf Wochen nach Beginn der Infektion vorhanden sind. Als PVS werden in der Öffentlichkeit nach einer Impfung (nicht notwendigerweise einer Covid-Schutzimpfung) auftretende schwerwiegende Nebenwirkungen bezeichnet. Die Krankheitserscheinungen bei PVS nach Covid-Schutzimpfung sind in etwa die gleichen wie bei PCS.
Für einen an PCS/PVS erkrankten Patienten ist die Behandlung meist wenig zufriedenstellend, weil die Medizin erst dabei ist, das Virus und seine Wirkungsweise zu verstehen. Daher gibt es noch keine Erfolg versprechende Therapie, sondern nur den Versuch, einzelne Symptome zu heilen. Entsprechend stellt sich die Behandlung dar: Zunächst erfolgt die hausärztliche Diagnostik, dann gibt es gegebenenfalls Überweisungen zu Fachärzten. Da es keinen Facharzt für PCS gibt, werden in der Regel Lungenfachärzte, Kardiologen, Neurologen, Psychiater, Rheumatologen oder HNO-Ärzte bemüht. Diese können das PCS-Syndrom auch nicht nachweisen, sondern betreiben Ausschlussdiagnostik. Der Kardiologe kontrolliert beispielsweise, ob eine Herzmuskelentzündung vorliegt. Meist verlaufen diese Untersuchungen aber ohne Befund. Die schlussendlich gestellte Diagnose ist oft ME/CFS, oder vereinfacht „chronisches Müdigkeitssyndrom“, und glänzt auch nicht gerade durch ihre Beweisbarkeit. Tritt im Laufe der Zeit keine Besserung ein, folgt die Rehabilitation. Mal ambulant, mal stationär. Oft verlaufen diese Maßnahmen ohne nennenswerten Erfolg.
Als Versicherter zweifelt man dann, ob man seine gesammelten Berichte der Fachärzte, die ja nur Ausschlussdiagnosen beinhalten, als Nachweis überhaupt einreichen kann. Das kann man natürlich, denn das ist ja das Einzige, was man vorweisen kann. Und hier schließt sich der Kreis zum Anfang dieses Artikels: Versicherer mit einer vernünftigen Einstellung akzeptieren dies als Nachweis für das Vorliegen einer bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit, weil das derzeit als leitliniengerechte Behandlung angesehen wird. Unternehmenskultur eben.
Diesen Artikel lesen Sie auch in AssCompact 09/2023 und in unserem ePaper.
Bild: © Sergey Nivens – stock.adobe.com
 Stephan Kaiser
Stephan Kaiser - Anmelden, um Kommentare verfassen zu können